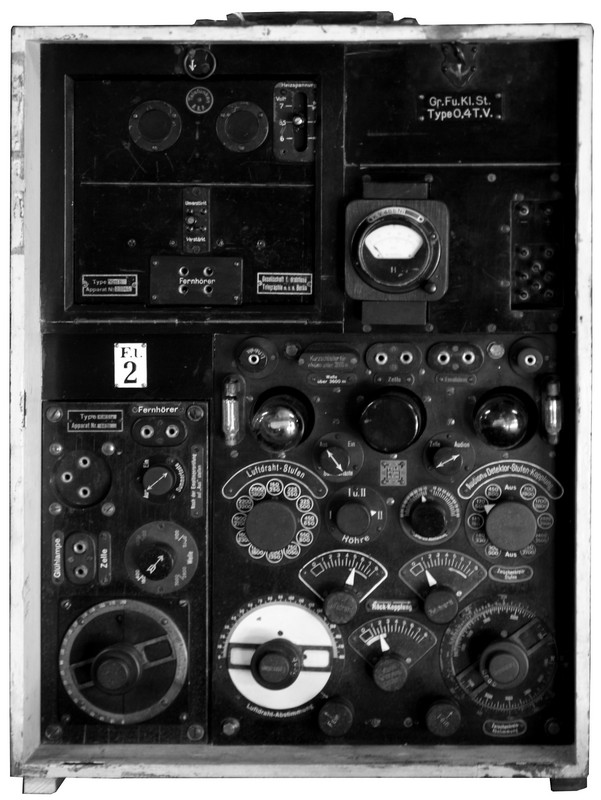Nach dem ersten Weltkrieg musste moderneres Material für die Funktelegraphie
beschafft werden, da die Funkerkompanien immer noch mit veralteten Löschfunkenstationen
aus den Vorkriegsjahren ausgerüstet waren.
Angesichts der sehr knappen finanziellen Verhältnisse wurden dank guter Beziehungen
zur deutschen Telefunkengesellschaft zunächst sechs (?) Stationen aus
Restbeständen der deutschen Reichswehr auf Protzfahrzeugen beschafft.
Mit der stürmisch verlaufenden technischen Entwicklung wurde das Material
in mehreren Schritten modernisiert und 1925 zu den nachgerüsteten sechs Stationen "Fahrbar Leicht"
weitere zehn Stationen erworben, alle 16 auf den neuen Stand gebrachten Funkstationen
erhielten die neue Bezeichnung "Fahrbar Leicht 25" (F.L.25).
Die von der Deutschen Gesellschaft für drahtlose Telegraphie, Berlin, entwickelte
Grosse Tonfunken - Kleinstation Gr.Fu.Kl.St.18 wurde 1919 in sechs Exemplaren beschafft.
Die Station war auf zwei Protzfahrzeugen, einachsigen Anhängern für Pferde-
oder Motorzug aufgebaut, eine Protze trug die Apparate, die zweite das
Antennenmaterial mit einem Teleskopmast.
Als Sender kam in der ersten Konfiguration von 1919 ein
Telefunken Löschfunkensender 0,4 TV für tönende
Telegraphie (B2) zum Einsatz. Dieser konnte im Bereich 170 - 1850 kHz abgestimmt
werden, die Antennenleistung lag bei 400 W, die Primärleistung bei 1000 W.
Als Empfänger wurde zunächst ein Primär- / Sekundär - Audionempfänger E213a
eingesetzt, der den Bereich von 86 kHz - 2000 kHz abdeckt und mit zwei Trioden
RE 11 bestückt ist.

Der Löschfunkensender 0,4 TV stellt den letzten Entwicklungsschritt von
Funkentelegraphiesendern dar, zum Zeitpunkt der Einführung bei den Schweizer
Übermittlungstruppen war das Gerät von den zwischenzeitlich eingeführten
Röhrensendern eigentlich bereits als überholt zu betrachten.
Der 40 kg schwere Löschfunkensender ist ein ein Sperrholzgehäuse eingebaut, die einzelnen
Bereiche sind durch Sperrholzfächer getrennt, Abschirmmassnahmen fehlen aber.
Technisch bestand der Sender aus einem Wechselstromkreis, dem unter Hochspannung
stehenden Schwingkreis ("Stosskreis") mit der Löschfunkenstrecke und der Auskopplung
der Hochfrequenz als Sendeenergie.
Im Wechselstromkreis wird in einem motorgetriebenen Mittelfrequenzgenerator
eine Wechselspannung von ca. 500 Hz, 300 V generiert, eine Gleichstrommaschine
erlaubt über einen Regelwiderstand die Beeinflussung der Erregerspule des
Wechselstromgenerators, der Erregerstrom im Primärkreis wird von einem Instrument
angezeigt. Die Tastung des Senders erfolgt durch die unter Spannung stehende
Morsetaste (die unten im Sender ausgeklappt werden kann) direkt im Primärkreis.
Im Hochspannungstransformator wird die Primärspannung auf die Hochspannung von
ca. 6 kV hochtransformiert, diese wird zum Betrieb der Funkenstrecke benötigt.
Die Löschfunkenstrecke ist im Sichtfenster im der linken Gerätemitte zugänglich,
sie besteht aus sechs Teilfunkenstrecken aus Kupferscheiben, welche durch isolierende
Glimmerscheiben in einem Abstand von 0,2 mm gehalten werden. Zum Betrieb einer Teil-Löschfunkenstrecke
ist eine Hochspannung von ca. 1 kV benötigt, durch Kurzschliessen von Abgriffen konnte
die Anzahl aktiver Teilfunkenstrecken reduziert werden, nach entsprechender
Reduktion der Sekundärspannung war eine Leistungsregulierung des Löschfunkensenders möglich.
Die von der Sekundärspannung betriebene Löschfunkenstrecke gehört zum Schwingkreis,
der als "Stosskreis" bezeichnet wird. Mit dem Stosskreis-Kondensdator und der
regulierbaren Stosskreis-Induktivität wird die Sendefrequenz definiert, die
Frequenzeinstellung konnte nur über Eichtabellen erfolgen, die Station verfügte
nicht über eine direkt ablesbare Frequenzskala.
Vom Fusspunkt der Stosskreis-Induktivität wurde die Sendeenergie ausgekoppelt und
mittels einer Antennenspule mit schaltbaren Abgriffen ("Antennenverlängerung") und
einem Antennenvariometer an die Antenne angepasst. Zur optimalen Antennenanpassung
wurde auf maximalen Antennenstrom am "Luftdrahtampèremeter" abgestimmt.
Als Empfänger kam der Telefunken Primär- Sekundärempfänger E213a zum Einsatz, im
Empfängerkasten waren zusätzlich der Niederfrequenzverstärker EV 211b und der Wellenmesser
KW 61e untergebracht.
Der Ein- / Zweikreis - Röhrenaudionempfänger verfügte über einen Detektor zum
Notempfang bei Röhrendefekt oder Ausfall der Batteriespeisung, da die Ausgangsleistung
der verwendeten Trioden zu gering war, musste ein zweistufiger Niederfrequenzverstärker
EV 211b nachgeschaltet werden, um ausreichende Ausgangsleistung für Kopfhörerempfang
zu erreichen. Sichtfenster im Holzkästchen des Niederfrequenzverstärkers erlaubten
die Kontrolle der funktionierenden Röhrenheizung.
Der Wellenmesser KW 61e erlaubte die Kontrolle von Sendefrequenz (eine Glühlampe
zeigte Resonanz mit dem Sender-Stosskreis an) und Empfangsfrequenz (ein Oszillatorsignal
des Wellenmessers wurde dem Empfänger zugeführt). Das von Sender ausgekoppelte
Antennensignal (und die Sende- / Empfangsumschaltung) erreichte den Empfängerkasten
durch ein Multipol-Flachbandkabel.
Als Antennenmaterial war eine sechsdrähtige Schirmantenne vom 15 m Teleskopmast
(mit sechs "hoch" abgehenden Gegengewichtsdrähten) auf dem Hinterwagen
oder eine zwischen zwei 12 m hohen Steckmasten ausgespannte 60 m T- oder L- Zweidrahtantenne
mit über dem Boden ausgespannten Gegengewichtsdrähten vorgesehen.

(Werksabbildung K+W aus Publikation von R. Ritter)
Die Stromversorgung erfolgte mittels Benzinaggregat Siemens MG 1949. Der
Benzinmotor treibt einen Wechselstromgenerator zur Erzeugung der Primärkreisspannung
von 300 V, 500 Hz, an. Ein gleichzeitig betriebener Gleichstromgenerator steuert
die Erregerwicklung der Wechselstrommaschine, mit einem Regelwiderstand ("Tonschieber")
kann der Erregerstrom und damit die Generatorspannung eingestellt werden.
Die maximale Primärkreisleistung von 1 kW ergab nach dem Hochspannungstransformator
eine maximale Antennenleistung von 400 W.

(Abbildung aus Publikation von R. Ritter)
Mit der Beschaffung und schrittweisen Umrüstung der "Fahrbar Leichten Funkstation"
auf den Röhren - Zwischenkreissender ARS 87 wurden die Sender 0,4 T.V. um 1926 abgelöst
und es kam 1926 das Ende der Löschfunkenära bei den Übermittlungstruppen der Schweizer
Armee.